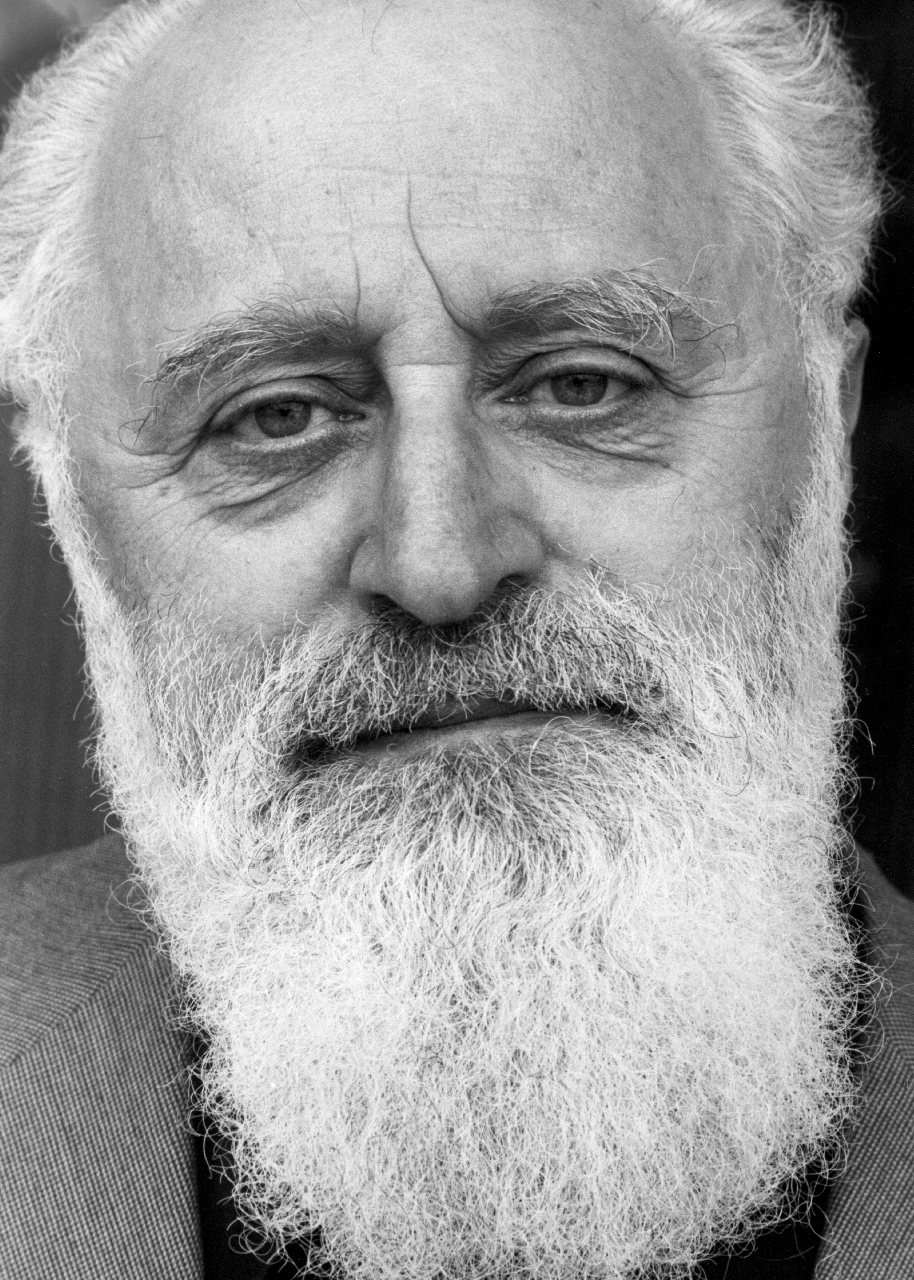Neuerscheinung: Jüdisch-christliches Bibellexikon nach mystischem Schriftsinn
Unter dem Titel „Das Mysterium der Offenbarung“ hat der Rottenburger Theologe, Buchautor und Stiftungsrat der Friedrich Weinreb-Stiftung, Dr. Klaus W. Hälbig, ein „jüdisch-christliches Bibellexikon nach dem mystischen Schriftsinn“ (so der Untertitel) vorgelegt.
Das im Fe-Verlag (Kißlegg/Allgäu) erschienene vierbändige Werk (mit jeweils über 600 Seiten) versteht sich als „mystagogische Einführung in Mysterium und Mystik der Bibel als göttlicher Offenbarung“. Es enthält nach zehn „Geleitworten“, Vorwort und einer knapp 70-seitigen Einführung 130 Artikel zu Grundbegriffen (davon 56 Begriffspaare), den wichtigsten biblischen Personen und Namen sowie zur inneren Sinnstruktur und Symbolik von Schöpfung und Bibel. Jeder Artikel umfasst 16 bis 20 Seiten und ist in sich abgeschlossen.
Das Lexikon ist kein bibelwissenschaftliches Nachschlagewerk; vielmehr will es die Bibel aus der Hand der Bibelwissenschaft wieder in die Hand des normalen Gläubigen mit seinen existentiellen Sinnfragen geben. Die beantwortet im Grunde schon das erste biblische Wort Bereschit, „im Anfang“ (Gen 1,1), was durch Buchstabenumstellung als Berit-esch, „Bund des Feuers“ (der Liebe Gottes) gelesen wird, sowie der erste Artikel „Abba (Vater, allmächtiger)“ (s. u.).
Aufgezeigt wird die innere Einheit der Offenbarung von Altem und Neuem Testament im Licht der mystischen Traditionen der beiden biblischen Religionen Judentum und Christentum, nicht zuletzt im Licht der jüdischen Kabbala. Damit soll einerseits der jüdisch-christliche Dialog befördert werden, andererseits will das Werk dem wachsenden Antisemitismus vor allem dadurch entgegentreten, dass es den „großen Reichtum des jüdischen Erbes“ vergegenwärtigt (S. 21).
Neues Einmaleins der Liebe
Eine der Grundlagen des Lexikons ist die biblische Zahlen- und Buchstabenmystik. Im Vorwort (S. 12) heißt es dazu: „Die Ordnung der Zahlen bildet die in der Welt selbst präsente Form der Weisheit Gottes, die vom menschlichen Geist erkannt werden kann“ (Heinz Meyer). Zentral dafür ist die Aussage in Weish 11,20: Gott hat alles „nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet“. Die Sprache der Zahlen ist die einzige universale Sprache (einschließlich der Musik).
Die Reihenfolge der hebräischen Buchstaben liegt dadurch fest, dass sie zuerst Zahlen sind. Jedes Wort hat von daher einen bestimmten Zahlenwert: Die „Leiter“ bis zum Himmel im Traum Jakobs, sulam, 60-30-40, hat so den Wert 130, ebenso Sinai, 60-10-50-10‚ als Ort des Empfangs der biblischen Offenbarung (Thora) durch Mose, sowie der 16. Buchstabe Ajin, 70-10-50 = 130, was „Auge“ oder „Quelle“ bedeutet mit dem äußeren Zahlenwert 70.
Analog zur 130 ist der Zahlenwert 13, so für ahawah, 1-5-2-5 = 13, „Liebe“, und für echad, 1-8-4, „eins/einer“. Das Glaubensbekenntnis Israels lautet JHWH echad: Gott ist eins/einer (Dtn 6,4), in Zahlen: JHWH = 10-5-6-5 = 26, das heißt 2 x 13 oder 2 x Liebe: Gottesliebe und Nächstenliebe, die beide wieder eins sind (vgl. Mt 22,37-40), und 1 x 13. Daraus ergibt sich 3 x 13 im Sinn von 1 x 1 x 1 oder auch von 111: die Eins auf allen drei Zeitebenen als innerer Zahlenwert des ersten Buchstabens Aleph, 1-30-80 = 111 (der äußere Wert ist Eins). Jesus ist im Kreis seiner zwölf Apostel „die Erfüllung der Zahl Dreizehn“ (Ephräm der Syrer).
Der geisterfüllte Mensch: Seher und Prophet
Wenn das menschliche „Auge“ nur die äußere Mannigfaltigkeit der sichtbaren Welt im Symbol der 70 (oder des ‚siebten Tages‘) sieht, dann ist es, wie auch Jesus in der Bergpredigt sagt (Mt 6,23), im Grunde „krank“. Das bedeutet nach Friedrich Weinreb, „dass sich bei dir das, was Offenbarung heißt, nicht offenbaren kann“ (Der Weg durch den Tempel, 2000, 196): Die Sinai-Offenbarung der Thora am „50. Tag“ (Pfingsten, griech. Pentecoste, hebr. Schwawuot), das heißt am Beginn der achten Woche (7 x 7 + 1) analog zum ‚achten Tag‘, in ihrem inneren, mystischen Sinn kommt dann nicht mehr im „Herzen“ des Menschen an, wie es doch für den Menschen als „Bild Gottes“ eigentlich hätte sein sollen (vgl. Dtn 10,14; Röm 10,8).
Empfangsbereit für die göttliche Offenbarung wird der Mensch aber erst im Glauben als innere Beschneidung des Herzens durch den (pfingstlichen) Geist Gottes (Dtn 30,6; Röm 2,28f; 5,5); dadurch wird er auch (wieder) zum Propheten (Joel 3,1-5; Apg 2,17). Der ‚Seher‘ oder Prophet heißt nach Weinreb auch „der Blinde“, hebr. pikeach, „in dem Sinn, dass diese äußeren Augen, das Auge der 70, ihm eigentlich wenig sagen und dass vor allem das Auge der 130 zu ihm spricht“ (vgl. Vorwort, S. 20). Offenbarung in diesem prophetischen Sinn kann sich danach nur ereignen, wenn das innere eine oder dritte Auge der ‚Kontemplation‘ (oder der Mystik), das sich beim ‚Sündenfall‘ als Öffnen der zwei Augen geschlossen hat (Gen 3,7), wieder öffnet (s. dazu den Artikel „Ursünde (Erbsünde)“).
Diese Öffnung und Wiederherstellung bewirkt der Heilige Geist im (Er-)Innern des Menschen (hebr. sachar bedeutet ‚männlich‘ und ‚erinnern‘, vgl. Joh 14,26). Der Geist wird nicht nur an Pfingsten in Fülle ausgegossen, sondern im Johannesevangelium schon mit Jesu Tod (vgl. Joh 7,38f; 16,7). Im Vorwort (S. 12) heißt es dazu: Jesus haucht „seinen am sechsten Tag am Kreuz ausgehauchten lebensschaffenden Geist (Joh 19,30) … den Aposteln am achten Tag zur Vergebung der Sünden ein wie Gott dem Adam im Paradies (Joh 20,22; Gen 2,7) und begründet damit die Erlösung der Welt“. ‚Erlösen‘, goel, 3-1-30, bedeutet vom Hebräischen her, die Eins (1) oder Einheit in die Form, gal, 3-30, zu bringen: „In allem, was Form ist, wird dann die Einheit erkannt“ (Weinreb, Der Weg durch den Tempel, 305).
Thora und Welt: Vision und Verwirklichung
Friedrich Weinreb ist für das jüdisch-christliche Bibellexikon die wichtigste jüdischen Referenzgröße; zu Wort kommen aber auch zahlreiche weitere jüdische Autoren wie Philo von Alexandrien, Samson Raphael Hirsch, Abraham Joshua Heschel, Gershom Scholem, Moshe Idel, Joseph Dan, Daniel Krochmalnik, Gabriel Strenger oder Adin Steinsaltz (1937–2020). Steinsaltz, nach dem „Time“-Magazin ein jüdischer „Jahrtausendgelehrter“, Philosoph, Talmud-Kommentator und bedeutender Kabbalist, schreibt in seinem Buch Die dreizehnblättrige Rose (2011) über das Verhältnis von Wort-Offenbarung (= Thora) und Werk-Offenbarung (= Schöpfung): „Die Beziehung zwischen Tora und Welt ist also die von Idee und Verwirklichung, von Vision und Erfüllung“ (vgl. Vorwort, S. 9).
Gottes ‚Vision‘ im Blick in die Thora und sein (im Grunde sakramentales) Schöpfungswerk übersetzt das Johannesevangelium in die Aussage: Gottes Schöpferwort (= Logos, geistige Thora) ist in Jesus, was „JHWH rettet“ bedeutet, „Fleisch“ geworden (Joh 1,14), damit „alle … eins“ sind (Joh 17,21), und zwar in der gläubigen Teilhabe an der einen „Eucharistie“ als Jesu „Fleisch für das Leben der Welt“ (Joh 6, 51). Nach der jüdischen Überlieferung steht das eine Volk Israel zwar den siebzig Völkern der Welt gegenüber, aber „eigentlich sind es 130 Völker, also sozusagen eines. Es ist eine Einheit“ (Weinreb, Der Weg durch den Tempel, 197).
Israel als ‚Braut‘ des ‚hochzeitlichen‘ Bundes mit Gott empfängt als erstes die Offenbarung am Sinai als ‚Brautgabe‘ Gottes, dann folgt im Neuen Testament (Neuen Bund) die Kirche, die mit ihren vier Wesenseigenschaften als die eine, heilige, katholische (universale) und apostolische Kirche alle „130“ Völker umfasst. Das eschatologische Ziel ist die allumfassende Einheit des Schöpfers mit seiner Schöpfung im Bild der mystischen ‚Hochzeit‘ (unio mystica).
Die Bibel: Ausdruck des Seins jenseits der Zeit
So wichtig wie die Zahlen in den biblischen Er-zählungen sind auch die 22 Buchstaben (oder Urzeichen) des hebräischen Alphabets; sie gliedern sich in 3 Vater-/Mutterzeichen, sieben (3 + 4) doppelt gesprochene und 12 (3 + 4 + 5) ‚einfache‘ Zeichen analog zu den zwölf Tierkreiszeichen, beginnend mit dem 5. Buchstaben He, der für das erste Zeichen ‚Widder/Lamm (Gottes)‘ steht. Die Bibel als „Schöpfung im Wort“ (Weinreb) beginnt mit dem zweiten Buchstaben Beth = „Haus“ (Beth-lehem bedeutet „Haus des Brotes“) im ersten Wort Bereschit, „im Anfang“.
Der „Anfang“, so heißt es im Vorwort (S. 9), „ist jenseits der Zeit und enthält schon das Ende; umgekehrt offenbart sich vom Ende her der Anfang ganz. Für die Heilige Schrift gilt das Prinzip: ‚Es gibt kein Vorher und kein Nachher‘, kein Früher oder Später: ‚Die Geschichte der Bibel ist Ausdruck des Seins; daher gilt in ihr unsere Zeitreihenfolge nicht‘ (Weinreb, Traumleben I, 1979, 215). Sie offenbart Gottes Sein als Liebe.“
Von daher ist die Offenbarung der Bibel „ein Mysterium, das sich eschatologisch, vom Ende her enthüllt als Geheimnis der Liebe des Schöpfers zu seiner Schöpfung als Braut, repräsentiert durch das Volk des Bundes“. Die zwölf Stämme Israels und die zwölf Apostel haben deshalb ihre Analogie in den zwölf Tierkreiszeichen, die für die ganze Schöpfung und das Jahr oder die Zeit stehen.
Wesentlicher Teil der Offenbarung ist der ursprünglich gottähnliche Mensch (in seiner ‚ewigen Natur‘) als Bild Gottes und Mikrokosmos mit seiner (mit dem Wort Gottes gegebenen) Sprache. Dadurch ist er berufen, die Schöpfung aus der endlichen Dualität oder Zweiheit ihrer gegensätzlichen Prinzipien (Geist und Materie, Himmel und Erde, Tag und Nacht, ‚männlich‘ und ‚weiblich‘) in die Einheit mit dem Schöpfer als Ursprung zurückzuführen. „Adam“ als Repräsentant der ganzen Menschheit im Garten „Eden“ (= Wonne) versagt bei dieser Aufgabe.
Die Zehn Worte des Schöpfers im ‚Anfang‘ („und Gott sprach“) gelangen erst an ihr Ziel in den „Zehn Worten“ am Sinai, den Zehn Geboten, beginnend mit Anochi (= Ich, also mit Aleph = Eins): Der Weg der Offenbarung, der die Umkehr des gefallenen und damit tierähnlich gewordenen Menschen notwendig einschließt, führt so von Aleph (Eins, Gott) zu Beth (Zwei, Schöpfung) und von Beth wieder zurück zu Aleph, was das Wort Abba (Vater) ergibt: 1-2-2-1.
Grunddualität ‚männlich‘ und ‚weiblich‘
Weil der gottähnliche Mensch in die Geschichte der Offenbarung hineingehört, werden auch seine leibhafte Gestalt und seine fünf Sinne ausführlich behandelt, so in den Artikeln „Bild Gottes (Mensch)“, „Geistseele und Körperseele“, „Ohr (Hören)“, „Auge (Sehen)“, „Wohlgeruch“ (des Opfers), „Herz“, „Hals und Joch“, „Hand und Fuß“ oder „Pferd und Esel“ einschließlich des Einhorns, die symbolisch für die unbewusste Triebstruktur stehen. Die Geistseite des Menschen thematisieren Artikel wie „Sprache“, „Logos“, „Sinn“, „Prophetie und Inspiration“, „Einheit und Zweiheit“, „Alphabet“ oder „Zahlen“.
Nicht ausgespart werden zudem theologisch heute so umstrittenen Themen wie „Ursünde“ (als Differenz zwischen dem ursprünglich zwei-einen und dem ‚natürlichen‘ Menschen), „Wahrheit und Lüge“, „Hölle und Fegefeuer“, „Teufel und Dämonen“ und das „Böse“, sowie andere vieldiskutierte Themen wie „Jungfrauengeburt“ (‚gebären‘ als ‚offenbaren‘), „Maria“ (als neue Eva), „Adam und Eva“, „Adams Rippe (Eva)“ oder „Mann und Frau“.
Nach der Zahlensymbolik (Bibel, Pythagoras, Philo, altes China) gelten die ungeraden Zahlen als ‚männlich‘ und die geraden Zahlen als ‚weiblich‘. Die für den gegenwärtigen Geschlechterdiskurs so fundamentale anthropologische Grunddualität ‚männlich‘ und ‚weiblich‘ spiegelt sich demzufolge biblisch auch im Gegenüber der Gegensätze von „Geistseele und Körperseele“, kosmisch von „Himmel und Erde“, „Sonne und Mond“, „Feuer“ (esch, 1-300) und „Wasser“ (majim, 40-10-40), in Zahlen: 1 und 2 beziehungsweise 3 und 4.
Die Siebenzahl der Schöpfung wird daher verstanden als Verbindung von ‚männlicher‘ Drei und ‚weiblicher‘ Vier, weshalb der Sabbat oder Schabbat (Schin-Beth-Taw, 300-2-400) als ‚siebter Tag‘ das Zeichen des ‚hochzeitlichen‘ Bundes von Gott mit seiner Welt ist; deren ewige Vollendung als ‚Hochzeit‘ ist symbolisiert im ‚achten Tag‘ (Sonntag) jenseits der mit der Sieben als „Zahl einer Mondphase“ (Joseph Ratzinger) repräsentierten Zeit- oder ‚Wasserwelt‘: Gott hat „den Mond gemacht als Maß für die Zeiten“ (Ps 104,19). Die liturgischen Festzeiten im jüdischen und christlichen Lunisolarkalender sind somit fest verankert in der geistigen Sinnstruktur der Schöpfung und Erlösung als Neuschöpfung (= ‚achter Tag‘).
Schöpfung als Horizont von Tod und Auferstehung Jesu
Jesu ‚Auferstehung‘ von den Toten „am dritten Tag … gemäß der Schrift“ (1 Kor 15,4) kann sich daher nur an einem Sonntag als ‚achten Tag‘ ereignen – gefeiert wird Ostern am ersten Sonn-tag nach dem ersten Frühlingsvollmond (vgl. die Artikel „Sabbat und Sonntag“ und „Ostern“). Jesu Heilstod am ‚Kreuz‘ am ‚sechsten Tag‘ oder Freitag geschieht dann analog zur Erschaffung des Menschen am ‚sechsten Tag‘ und seinem ‚Fall‘ am gleichen Tag (vgl. Gen 1,28-31; 2,17; so auch der Babylonische Talmud, Sanhedrin 38b).
Die „in Geburtswehen“ liegende Schöpfung (Röm 8,22) in den Zahlen Sechs (2 x 3) und Sieben (3 + 4) wird durch die Erlösung als ‚Neuschöpfung‘ überstiegen in die Zahl Acht als „Zahl der Vollkommenheit des Kosmos“ (Günter Spitzing). Entsprechend ist der Mensch das achte Schöpfungswerk (am 3. und 6. Tag sind es je zwei Schöpfungstaten). Die Acht steht für die ‚Sonne‘ (Geist, Vernunft) und die kommende Welt oder das ‚Gelobte Land‘ – die Taufe in ‚acht-eckigen‘ Becken hieß bei den Kirchenvätern das „Mysterium der Achtzahl“. Die Bergpredigt Jesu beginnt entsprechend mit acht Seligpreisungen der Erlösten (Mt 5,3-10).
Die Beschneidung des neugeborenen Knaben (auch Jesu: Lk 2,21) erfolgt daher notwendig am „achten Tag“ als Vorwegnahme der endgültigen Befreiung von der ‚Umhüllung‘ durch das sterbliche ‚Fleisch‘. Bevor Josua das Volk Israel nach dem Auszug aus ‚Ägypten‘ (= ‚sechster Tag‘) und der 40-jährigen Wüstenwanderung (= ‚siebter Tag‘) in das ‚Gelobte Land‘ (= ‚achter Tag‘) führen kann, muss er „die Israeliten auf dem ‚Hügel der Vorhäute‘“ beschneiden (Jos 5,3). Er selbst heißt „Sohn des Nun“ (Dtn 34,9; Jos 1,1), Sohn der „Fünfzig“ (analog zur Acht).
Auf dem Dreischritt sechster, siebter, achter Tag als Einheit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bei Gott (christlich das österliche Triduum) basieren Artikel wie „Exodus“, „Festkalender“, „Heilsplan“, „Heilsgeschichte“ oder „Pfingsten und Babylon“. Die Ausgießung des Geistes Gottes in Fülle am ‚50. Tag‘ hebt als pfingstliche Spracherneuerung die Sprachverwirrung beim ‚Turmbau zu Babel‘ wieder auf, wobei ein enger Zusammenhang besteht zwischen der Verwirrung in ‚Babel‘ und der ‚Sintflut‘ als mabul (‚Vermengung‘); denn die ‚Arche‘, teba, in der acht Menschen (vier Männer und vier Frauen) gerettet werden, bedeutet ‚Wort‘, ‚Sprache‘. Ursprünglich wurzelt jede Sprache im Ewigen oder Heiligen und kann von daher eine Brücke sein zum ‚Himmel‘: zur spirituellen Welt oder zum Wesentlichen.
Vierfacher Sinn der Heiligen Schrift
Auf der Umschlagseite (und in der Einführung) wird verwiesen auf den vierfachen Sinn der Heiligen Schrift nach der jüdischen und der christlichen Tradition. Danach hat die Bibel „nicht nur einen buchstäblichen Sinn (Literalsinn), sondern auch einen inneren geistigen (geistlichen) Sinn, der noch einmal dreifach untergliedert wird: in den allegorischen oder typologischen Sinn (Entsprechungen zwischen dem Alten und Neuen Testament) zur Stärkung des Glaubens, einen moralisch belehrenden Sinn für das Handeln in Liebe und einen anagogischen, ‚zum Himmel hinaufführenden‘ Sinn, der die Hoffnung auf das ewige Leben bei Gott nährt und der eigentlich mystische Sinn ist“.
Dieser dreifache geistige Sinn verbindet „den biblischen Buchstaben mit dem Geist, das Bild mit dem Wesen, das Zeitliche mit dem Ewigen, das Werdende mit dem Sein, das Irdische mit dem Himmel, was mit dem ‚Bund‘ gemeint ist. Die Bibel wird dann Ausdruck des ewigen Seins und erschließt eine Ontologie der Liebe, durch die sie relevant ist für alle Zonen und Zeiten, nicht zuletzt eben auch für unsere Gegenwart.“
Vier griechische Ikonen als Titelbilder
Jeder Band des Lexikons hat ein eigenes Titelbild (auf Umschlag und Buchdeckel), und zwar jeweils griechische Ikonen, bezogen zweimal auf das Alte und zweimal auf das Neue Testament. Die erste Ikone aus der orthodoxen Dreifaltigkeitskirche (Griechenkirche) in Wien stellt den Besuch Gottes in Gestalt von drei Männern oder Engeln bei Abraham und Sarah „zur Zeit der Mittagshitze“ dar (Gen 18,1); sie gilt in der Orthodoxie als das Bild der Dreifaltigkeit. Mit dem Beschneidungsbund werden die Namen Abram und Sarai verwandelt in Abraham und Sarah (Gen 17,5.15): Sie erhalten die beiden He aus dem Gottesnamen JHWH.
Die anderen drei Ikonen (von Klöstern im Osten der Insel Kreta) zeigen einmal die Begegnung Jesu „um die sechste Stunde“ (die Zeit der Mittagshitze) am Jakobsbrunnen mit der samaritanischen Frau, der er das „Wasser“ (des Geistes) anbietet, das in ihr „zur sprudelnden Quelle“ (zur inneren Offenbarung) wird, „deren Wasser ewiges Leben schenkt“ (Joh 4,14); zum anderen wird Mose dargestellt, der von Gott (im Symbol der Hand) an Pfingsten auf dem Sinai die Thora mit den Zehn Geboten (5 + 5: Gottesliebe und Nächstenliebe) als Kern des ‚hochzeitlichen‘ ewigen Bundes empfängt (der Gottesname JHWH, 10-5-6-5, ist von daher zu lesen als 10 = 5 + 5; der 6. Buchstabe Waw zwischen den beiden He bedeutet ‚und‘).
Die vierte Ikone zeigt Maria als Typus der Elousa, als ‚Mitleidende‘, ‚Erbarmerin‘, oder als Glykophilousa, die ‚zärtlich Küssende‘, als Halbfigur mit ernstem Gesichtsausdruck, die mit beiden Händen liebevoll ihren Sohn umfängt, der – wie es im Vorwort (S. 24) heißt – seinerseits „sich ihr zuneigt, sich an ihre Wange schmiegt, sie mit seiner Rechten berührt und halst und in der Linken die Schriftrolle trägt; seine beiden Füße sind entblößt. Als neuer Adam wird Jesus von seiner Mutter jungfräulich empfangen und geboren, die so die neue Eva ist und damit die ‚paradiesische Frau‘, das heißt nach dem Hohelied der Liebe ‚die Schönste der Frauen‘ (Hld 1,8), die sagt: ‚Mit Küssen seines Mundes bedecke er mich. Süßer als Wein ist deine Liebe‘ (Hld 1,2).“ Das Hohelied (wozu es im Lexikon einen eigenen Artikel gibt, ebenso zu „Liebe“) gilt der jüdischen und christlichen Mystik als ein zentraler Schlüsseltext.
Die Bibel – ein fremdes Buch
Das erste der zehn an den Anfang gestellten „Geleitworte“ (S. 5) stammt aus dem u. a. von Josef Subrack herausgegebenen Buch Große Mystiker – Leben und Wirken (1984); dort heißt es im Artikel zu Hildegard von Bingen: „Der Leser von heute, dem trotz seines christlichen Glaubens die Bibel ein fremdes Buch geworden ist, muss sich bewusst machen, dass darin Gottes Wort in einmaliger Weise Menschenwort geworden ist, dass dieses Buch ihm Zugang schenkt zu Gottes ewigem Sinnen und Planen, dass er die Geschichte der Liebe Gottes zu den Menschen und zur Welt dargestellt findet, das Auf und Ab des Alten Testaments und das endgültige, unüberholbare Ja der Menschwerdung Gottes, von der das Neue Testament berichtet“ (Führkötter/ Sudbrack).
Hinweis: Das Mysterium der Offenbarung. Jüdisch-christliches Bibellexikon nach dem mystischen Schriftsinn, 4 Bde., ISBN 978-3-86357-426-0, 89,90 €(Einzelband 25 €); Klaus W. Hälbig (geb. 1951) war viele Jahre Pressesprecher der Diözese Rottenburg-Stuttgart und anschließend Studienleiter für „Religion und Öffentlichkeit“ an der Diözesanakademie in Stuttgart; er ist Autor zahlreicher Bücher und Veröffentlichungen zur spirituellen Theologie und Mystik.